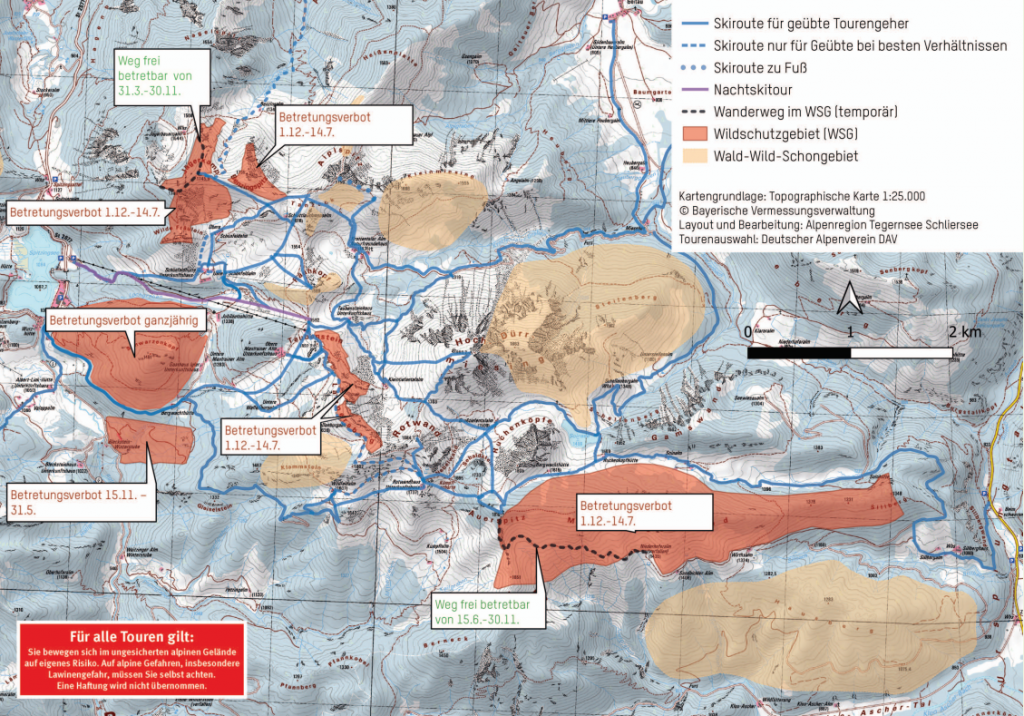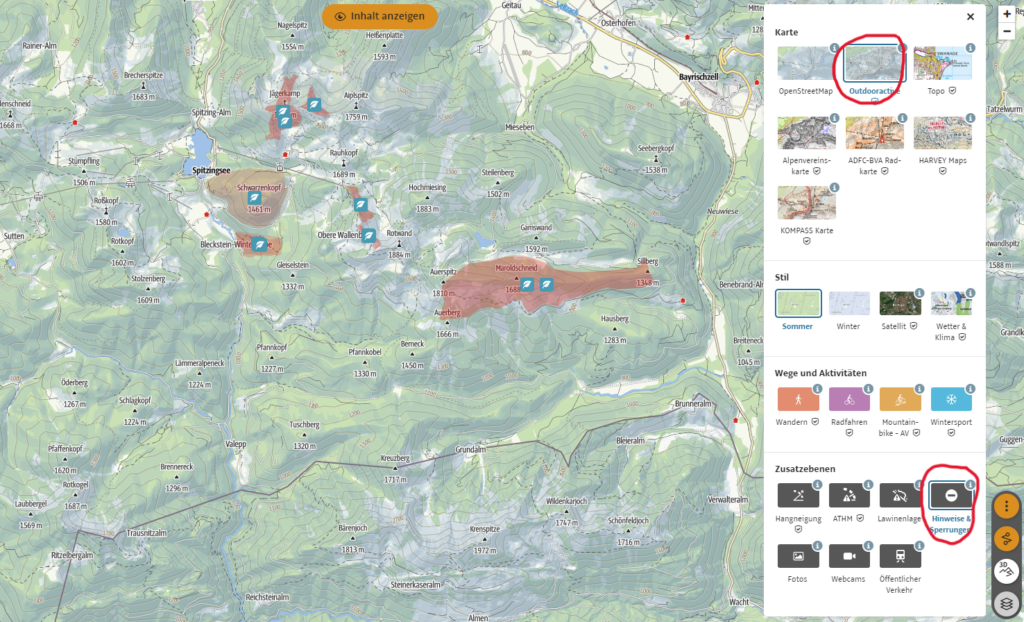Orientierung
In dieser Lektion bekommst du viel ökologischen Input. Es geht um das Ökosystem Alpen, dessen Höhenstufen, die Artenvielfalt sowie die Anpassung an diesen teilweise extremen Lebensraum.
Fakten
Alpine Höhenstufen
Flora
Pionierpflanzen
Nach zerstörerischen Ereignissen wie z.B. Lawinen- oder Murenabgängen und auf Gletschervorfeldern siedeln sich auf diesen oft sandigen Böden zunächst Pionierpflanzen an. Wenn diese absterben, hinterlassen sie eine Humusschicht, welche wiederum anderen Pflanzen das Wachstum ermöglicht.
Auf den Weg machen
Hier kommen ein paar Aufgaben, um dein Wissen zu testen! Bring zunächst die Höhenstufen in die richtige Reihenfolge und ordne im Folgenden die Pflanzenarten zu!
Zusammenfassung
Alpine Lebensräume
Schnee + Eis
Einige Arten haben sich so gut an die für Menschen teils lebensfeindliche Umgebung angepasst, dass sie hier ihre bevorzugten Lebensbedingungen finden. Beispielsweise entsteht farbiger Schnee durch Algen, die an die Schneeoberfläche treten und sich als UV-Schutz rot färben (“Blutschnee”). Im Tierreich sind es vor allem wirbellose Organismen, die in Schnee und Eis vorkommen (z.B. Springschwänze, Steinfliegen, Spinnen,…).
Schutt + Fels
Auch in diesem Lebensraum gibt es spezielle Anpassungen. So ist zum Beispiel der Gletscher-Hahnenfuß die am höchsten steigende Alpenpflanze (gefunden auf bis zu 4200m). Zu finden ist er oft in Schuttfeldern.
Sogar in Felsnischen und Felsritzen gibt es Pflanzen. Der Steinbrech beispielsweise ist in den Alpen mit bis zu 40 verschiedenen Arten vertreten und kann selbst die kleinsten Felsritzen besiedeln. Dabei bildet er um die Blütenkrone ein grünes Polster, das Feuchtigkeit speichert.
Alpine Gewässer
Von den kleinsten Pfützen bis hin zu großen Bergseen – alpine Gewässer besitzen eine unglaubliche Artenvielfalt. Von Mikroorganismen, über Phyto- und Zooplankton hin zu Amphibien.
Abiotische Faktoren
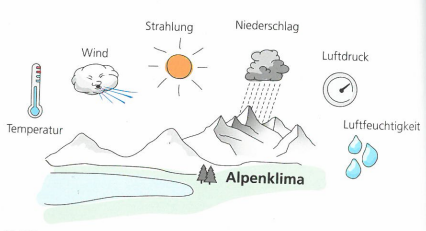
© 2022 Sektion München des DAV e.V.